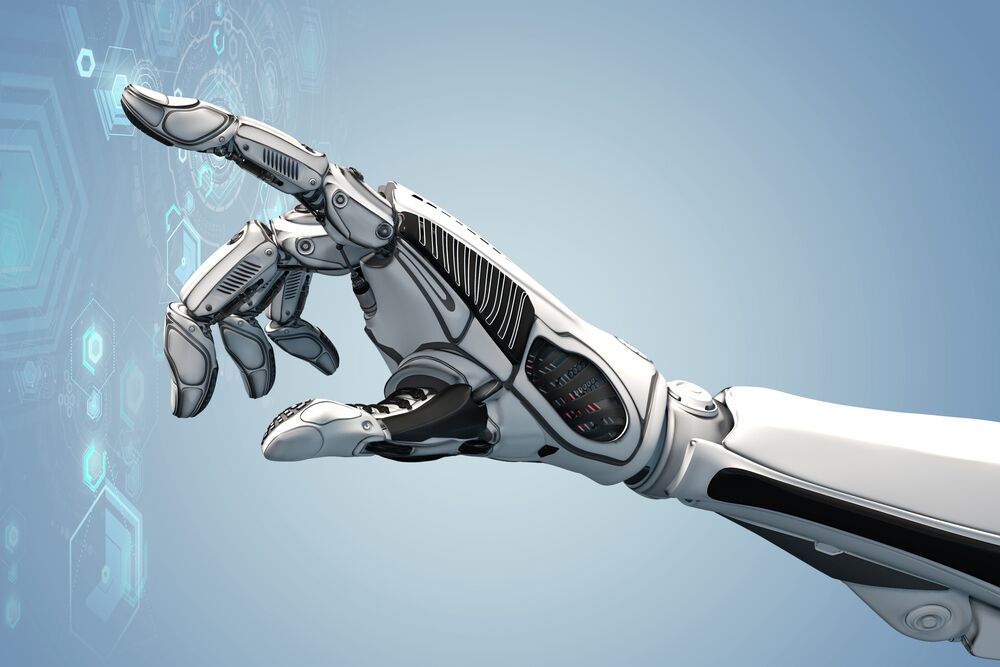Foto: Willyam Bradberry/Shutterstock.com
Ein Roboter, der einen Arzt ersetzt, oder Maschinen, die Diagnosen stellen – das alles sind heute noch Zukunftsszenarien. Technisch gesehen sind wir davon jedoch nicht mehr weit entfernt, sagt Dr. Philipp Daumke, Geschäftsführer der Firma Averbis, die sich mit Data Mining und Text Mining im Bereich der Medizin beschäftigt. Er sagt: Die Diskussion um den Einsatz von Daten in der Medizin wird oft zu einseitig geführt.
Von Annabell Bialas und Bettina Ansorge
Herr Dr. Philipp Daumke, wohin glauben Sie wird uns die Digitalisierung in der Medizin und der Medizintechnik noch hinführen? Dahin, dass wir bald nicht mehr zum Arzt gehen, sondern dass ein Computer eine Diagnose stellen wird?
Ja, zumindest bei komplexen oder seltenen Krankheiten ist es jetzt schon so, dass Computer bei der Diagnose helfen können. Man muss aber immer dazu sagen, dass der überwiegende Anteil der Krankheiten, beispielsweise ein grippaler Infekt, leicht vom Arzt diagnostiziert werden kann. Dafür braucht es keinen Computer.
Es sind dann also eher schwierige Fälle und seltene Krankheiten bei denen Data Mining und Text Mining zum Einsatz kommen?
Vor allem, ja. Man sagt, dass sich das medizinische Wissen alle fünf Jahre verdoppelt. Das kann kein Mensch alleine mehr beherrschen. Nehmen wir beispielsweise die Wechselwirkungen von Medikamenten. Es gibt derzeit ca. 50.000 rezeptpflichtige Medikamente in Deutschland und beliebig viele Kombinationen davon. Wenn ein Patient beispielsweise fünf oder zehn Medikamente bekommt und es darum geht, herauszufinden, welches Medikament mit welchem interagiert, dann können Computer jetzt schon helfen. Es wird aber noch sehr lange dauern, bis der Computer den Arzt ersetzt.
Warum wird das denn noch dauern?
Da fehlt schon noch einiges. Da ist beispielsweise das Thema medizinische Daten. Big-Data-Technologien benötigen in der Regel große Mengen von Daten, mit denen die Systeme trainiert werden können. Aufgrund der hohen Anforderungen des Datenschutzes ist es im Bereich Healthcare sehr schwierig, an große Datenmengen zu gelangen. Daher hinkt Big Data in Healthcare anderen Branchen, in denen es leichter ist, an Daten zu kommen, typischerweise ein paar Jahre hinterher. Ein zweites großes Thema ist Vertrauen. Selbst wenn Computer irgendwann besser als Menschen in der Lage sind, Diagnosen vorherzusagen und die bestmögliche Therapie zu wählen, so ist der Vorbehalt gegenüber Maschinen deutlich größer als gegenüber Menschen. Es wird Zeit brauchen, bis Patienten und Ärzte Computern vertrauen werden.
Inwiefern hat denn Data Mining bisher die Medizin schon verändert?
Da sind viele Dinge, die man hervorheben kann. Das ganze Thema Genomsequenzierung ist hochspannend. Bei 23andMe kann man für wenige Hundert Dollar Speichelproben einsenden und erhält eine recht detaillierte Analyse seiner DNA. Beispielsweise Wahrscheinlichkeiten, an einer bestimmten Krankheit zu erkranken. Ein weiteres Beispiel ist die Bilderkennung. Auch sie ist massiv besser geworden, so dass man zum Beispiel kleine Tumore viel genauer erkennen kann.
Man muss aber auch erst einmal an die Daten kommen und braucht ja eine Menge an Daten. In der Medizin ist das nicht so einfach. Wie gehen Sie da vor?
Zunächst einmal muss man sagen, dass das klassische Vorgehen beim Data Mining, erst einmal Daten zu sammeln und dann nach Signalen in den Daten zu fahnden, aus Datenschutzgründen nicht erlaubt ist. Da braucht man zuerst eine sehr konkrete Idee, nach welchem Signal man eigentlich suchen möchte, bevor man projektspezifisch für diese Fragestellung einen Forschungsantrag stellen und eine Datenfreigabe erwirken kann. Hierfür schließen wir Kooperationen mit Krankenhäusern oder auch mit niedergelassenen Ärzten. In aller Regel bleiben die Daten dann auch in den Krankenhäusern, d.h. die Software muss in den Krankenhäusern installiert werden. Diese projektbezogene Datenfreigabe und lokalen Installationen verzögern den Fortschritt im Bereich Data Mining enorm. Unsere Projekt-Zyklen sind deshalb deutlich länger als in anderen Branchen.
Es gibt weitere Möglichkeiten, an Daten zu gelangen. Patienten können ihre Gesundheitsdaten in Web-Portalen online posten, wie es beispielsweise bei PatientsLikeMe geschieht. Chronisch kranke Menschen haben ein starkes Bedürfnis, dass ihre Daten für die Forschung verwendet werden.
In anderen Ländern, zum Beispiel in England, wird mit dem Thema Datenschutz freizügiger umgegangen. In England sammelt beispielsweise der NHS die Daten von niedergelassenen Ärzten und stellt sie in der Clinical Practice Research Datalink (CPRD)-Datenbank in anonymisierter Form zur Verfügung. Über 1.700 Publikationen sind hieraus bereits hervorgegangen. Das heißt, wenn man als Data-Miner überlegt, an Daten zu kommen, heißt das häufig auch, in andere Länder zu gehen.
Und die Menge an Daten ist wahrscheinlich vom jeweiligen Projekt und der Forschungsfrage abhängig?
Ja. Aber auch das sei an dieser Stelle gesagt, wenn wir über klinische Daten von Patienten sprechen, also Diagnosen, Symptome, Medikamente, Laborwerte usw., dann sprechen wir nicht über Big Data. Da wird der Begriff häufig missbraucht. Im Healthcare-Umfeld kann man, je nach Definition, bei der Genomsequenzierung oder bei der Bilddatenverarbeitung über Big Data sprechen, aber bei der Analyse von sonstigen Patientendaten sprechen wir eher über Daten im Mega- bis Gigabytebereich.
Ab wann ist man denn im Bereich Big Data?
An der Datenmenge kann man das nicht fest machen, die wird kontinuierlich nach oben geschoben. Es gibt die klassischen 3Vs (Volume, Velocity und Variety) sowie weitere Charakteristika wie Cloud-Computing und Machine Learning, die Big Data definieren. In meinen Augen sind viele Big-Data-Aspekte derzeit in Healthcare nicht erfüllt, beispielsweise der Zugriff auf Daten und die Möglichkeit, Daten in der Cloud zu verarbeiten. Daher fällt es mir schwer, in Healthcare das Schlagwort Big Data allzu oft zu benutzen.
Davon ist man also noch ein bisschen entfernt?
Ja, zumindest in Deutschland. Dass hier millionenfach medizinische Daten routinemäßig für Forschung und eine bessere Versorgung erhoben und ausgewertet werden, gibt es in absehbarer Zeit nicht. Das hat vor allem organisatorische Gründe und Datenschutzgründe.

Philipp Daumke: Daten können heilen helfen. Bild: Averbis.
Stichwort Datenschutz: Medizinische Daten sind ja sehr intime Daten, die gesammelt und ausgewertet werden. Viele Leute haben Angst, dass die Daten missbraucht werden. 82 % der Deutschen haben laut einer Bitkom-Studie Angst davor. Wie stehen Sie dem gegenüber?
Man muss das ein bisschen in Relation setzen. Wenn man die Leute fragt: „Haben Sie Angst vor Datenmissbrauch ihrer medizinischen Daten?“, beantwortet diese Frage natürlich jeder Befragte unmittelbar „Ja“. Gleichzeitig verkauft Amazon gerade massiv mit Amazon Echo einen Lautsprecher, der in der Wohnung Gespräche mithören kann. Da scheinen die Bedenken deutlich geringer zu sein, sich so etwas in die Wohnung zu stellen.
Man muss unterscheiden zwischen kranken Patienten und Gesunden. Gesunde Menschen haben Angst davor, dass ihre Daten missbraucht werden. Todkranke Patienten wollen, dass ihre Daten für die medizinische Forschung benutzt werden. Wenn jemand eine Diagnose Krebs hat oder wenn er an einer chronischen Krankheit leidet, dann hat er ein massives Interesse, dass seine Daten benutzt werden, damit es ihm besser geht und er vielleicht länger lebt und eine Perspektive hat.
Und diese Diskussion wird häufig zu einseitig geführt. Datenschützer meinen bisweilen, sie müssen die Patienten vor sich selber schützen. Was dann unter den Tisch fällt, ist, wie der Patient leidet und wie lebensverkürzend der Datenschutz selber wirken kann. Patienten sterben vielleicht früher, weil mit den Daten nicht geforscht wird. Patienten geht es schlechter, weil die Forschung behindert wird. Das sind Aspekte, die man beim Datenschutz auf jeden Fall mit diskutieren muss. Natürlich will kein Mensch, dass seine Daten öffentlich in einer Cloud hängen. Aber Menschen, die an einer chronischen oder lebensbedrohlichen Krankheit leiden, haben auch ein massives Interesse daran, dass mit ihren Daten geforscht wird.
Glauben Sie, dass der Datenschutz die Entwicklung in Zukunft hemmen wird, oder haben Sie das Gefühl, dass die Gesellschaft sich eher dahin entwickelt, diese Standards etwas zu lockern, weil sie erkennen, welchen positiven Nutzen das auch haben kann?
Prinzipiell geht es in die Richtung, dass der Patient entscheidet, was mit seinen Daten geschieht. Im Krankenhaus wird er künftig gefragt werden: „Willigen Sie ein, dass Ihre Daten in anonymisierter Form zu Forschungszwecken benutzt werden?“ Es hängt dann entscheidend davon ab, wie gut man die Patienten in kurzer Zeit davon überzeugen kann, dass die Bereitstellung ihrer Daten für die Forschung von enormem öffentlichem Interesse ist – zum Wohle der Patienten. Wenn die Patienten einwilligen, dann kann man mit den Daten intensiv forschen. Das ganze Thema Einwilligungsmanagement steckt allerdings meines Wissens bei vielen Krankenhäusern noch in den Kinderschuhen.
Abgesehen vom Datenmissbrauch: Inwiefern könnte es auch gefährlich werden, wenn die Mediziner mehr und mehr auf die Daten vertrauen?
Meines Erachtens ist die Gefahr, dass ein Arzt einen Fehler macht, künftig größer als die, dass die Maschine einen Fehler macht. Die Gefahr von Fehlern durch Maschinen wird man irgendwann beherrschen und zu sehr großen Teilen ausschließen können. Dann ist der Mensch das Unberechenbare in diesen Systemen und nicht mehr die Maschine.
Wenn Sie also in Zukunft zum Arzt gehen, würden Sie dann lieber noch dem Arzt aus Fleisch und Blut die Hand schütteln oder eventuell irgendwelche Daten in den Computer eingeben oder mit einem Roboter kommunizieren?
Da bin ich natürlich ein bisschen gebiased, ich als Techie brauche nicht unbedingt jedes Mal einem Arzt die Hand zu schütteln. Wenn bestimmte Routine-Untersuchungen durch Maschinen ausgeführt werden können, dann ist mir das lieber, als dass ich zwei Stunden im Wartezimmer sitze, nur um einem Arzt live zu begegnen. Allerdings wird das noch viele Jahre dauern, bis man soweit ist. Wie gesagt: Vieles entwickelt sich im Gesundheitswesen langsamer als man denkt, und einen Arzt wird es künftig immer brauchen.
Mit der Averbis GmbH ist Dr. Philipp Daumke unter anderem bei dem vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie geförderten Projekt Cloud4Health beteiligt, das die sichere Verarbeitung personenbezogener, medizinischer Daten im Bereich Healthcare Analytics anbietet.
Und das sind die Autorinnen Annabell Bialas: Aufgewachsen im Ruhrgebiet hat es mich für das Volontariat zu einer lokalen Tageszeitung nach Ostwestfalen verschlagen. Mit vielen neuen Eindrücken und Erfahrungen setze ich nun mein Journalistik-Studium mit dem Schwerpunkt Musik in Dortmund fort. Als Journalistin liegen mir besonders Menschen und ihre spannenden Geschichten am Herzen. Bettina Ansorge: Ich wurde Ende der 80er im schönen Ruhrgebiet geboren. Nach einigen Semestern Jurastudium in Bochum habe ich einen neuen Weg eingeschlagen und in Dortmund Journalistik studiert. Als Journalistin liebe ich es, Dinge zu hinterfragen und aus einer neuen Perspektive zu betrachten.